Bitte ungleich behandeln
Knapp 1,80 Meter groß, etwa 85 Kilo schwer. Ein X- und ein Y-Chromosom. An diesem Durchschnitt orientiert sich mehr oder weniger die medizinische Forschung – noch. Prof. Dr. Anke Hinney setzt sich für den Wandel ein.
Von Jennifer Meina
Frauen sind biologisch gesehen nicht einfach kleinere und leichtere Männer. In der Regel haben sie mehr Fettgewebe und einen höheren Wasseranteil, Männer mehr Muskeln und einen anderen Knochenbau. Beide empfinden Schmerzen anders. Ihre Organe arbeiten unterschiedlich schnell, sind ungleich schwer und groß. Das hormonelle Innenleben der Frau unterliegt lebenslangen Schwankungen, das des Mannes ist dagegen eine leicht sinkende Kurve. Und doch: Immer noch gilt der Mann in der medizinischen Forschung als Norm – bei der Diagnose von Erkrankungen, bei der Dosierung von Medikamenten und bei der Therapie. Wie riskant das ist, weiß Anke Hinney. Die Leiterin der Forschungsabteilung Molekulargenetik in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters ist Professorin für Molekulargenetik von Adipositas und Essstörungen unter Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen Aspekten.
„Wenn die Krankheit beim ‚falschen‘, das heißt unüblichen Geschlecht auftaucht, kann das nicht nur eine schlechtere Behandlung mit sich bringen, sondern teils auch tödliche Folgen haben.“ Dass die Symptome bei einem Herzinfarkt oft unterschiedlich sind – bei Frauen statt des Brustschmerzes und der Kurzatmigkeit eher Übelkeit und Magenbeschwerden auftreten –, ist mittlerweile bekannt. Andere Erkrankungen werden erst gar nicht in Betracht gezogen, wenn das ‚unübliche‘ Geschlecht betroffen ist. So sind von Osteoporose ab einem höheren Alter etwa 40 Prozent der Frauen betroffen, aber nur 20 bis 30 Prozent der Männer. Das ist zwar weniger, aber längst nicht so wenig wie man allgemein annimmt. Dennoch: Der Bruch des Hüftkopfes oder Probleme mit der Wirbelsäule werden beim Mann kaum mit Knochenschwund in Verbindung gebracht. Auch psychiatrische Störungen zeigen nicht selten eine Geschlechtswendigkeit; so finden sich beispielsweise Essstörungen weit häufiger beim weiblichen Geschlecht als beim männlichen. Ein weiteres Beispiel betrifft den Brustkrebs. Zwar sind Männer sehr selten davon betroffen, doch wenn, dann wird der Tumor meistens erst sehr spät diagnostiziert. Denn welcher Mann tastet sich regelmäßig die Brust ab – und geht bei einem Verdacht auch noch zum Arzt oder zur Ärztin für Frauenheilkunde?
»Wenn die Krankheit beim ‚falschen‘, das heißt unüblichen Geschlecht auftaucht, kann das nicht nur eine schlechtere Behandlung mit sich bringen, sondern teils auch tödliche Folgen haben.«

BLINDE FLECKEN VERMEIDEN
„Es gibt unzählige dieser Beispiele“, macht Hinney deutlich. Ein Umdenken sei deshalb dringend erforderlich – in der Gesellschaft einerseits, aber vor allem auch in der Forschung und Praxis. Und es tut sich etwas. An der Medizinischen Fakultät der UDE wird seit 2020 „Gendermedizin“ (siehe Infokasten) als Wahlfach angeboten. Gemeinsam mit dem Essener Kolleg für Geschlechterforschung (EKfG) bilden Prof. Dr. Hinney, Privatdozentin Dr. Andrea Kindler-Röhrborn und Prof. Dr. Arzu Oezcelik ein Team. Es unterstützt andere Wissenschaftler:innen der Medizinischen Fakultät und der Uniklinik dabei, Unterschiede der Geschlechter in neuen Projekten zu berücksichtigen. „Damit sollen blinde Flecken in der Forschung vermieden und die wissenschaftliche Qualität der Ergebnisse erhöht werden“, so Hinney.
Doch noch erkennen die meisten diesen blinden Fleck erst zufällig. „Viele führen ihre Studien durch und schauen dann im letzten Schritt, wie die Datensätze sich zwischen den Geschlechtern unterscheiden – sobald sie sehen, wie unterschiedlich teilweise die Ergebnisse sind, sind sie überrascht.“ Mittlerweile sind es in Essen rund 30 Kolleg:innen, die sich mit geschlechtersensibler Medizin auseinandersetzen und diese bewusst in ihren Studien beleuchten.
Ein Problem ist, dass ältere Studien Daten an Frauen schlicht nicht erhoben haben. Nicht nur in der Medizin ist dieser Gender-Data Gap erheblich. In vielen Lebensbereichen wird sich traditionell an männlichen Bedürfnissen orientiert. Beim Handydesign ist das für Frauen zumindest nicht gefährlich. Anders sieht es bei Auto-Crashtests aus. Oder bei Medikamenten.
Arzneien etwa wurden jahrzehntelang nur an Männern getestet. Das war gut gemeint: Der weibliche Zyklus musste nicht berücksichtigt und Schwangerschaften konnten nicht gefährdet werden. „Ein Problem ist, dass Medikamente, die bei Männern nicht angeschlagen haben und deswegen in der Testphase aussortiert wurden, bei Frauen vielleicht gewirkt hätten“, so Hinney. Die Biologin gibt zu: Indem Frauen in die Studien mit einbezogen werden, wird einiges komplizierter. Denn nun braucht es doppelt so viele Proband:innen – oder auch doppelt so viele Tiere im Labor. Aber das ist für sie alternativlos: „Wir möchten ja keine verzerrten Ergebnisse, sondern eine Medizin, der objektive Daten zugrunde liegen.“

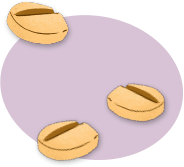
AUSGLEICHENDE BENACHTEILIGUNG
Ihr Aha-Erlebnis hatte Hinney bei ihrer Analyse genetischer Mechanismen für Essstörungen. Einige der genetischen Mechanismen, die das Körpergewicht regulieren, sind auch für Essstörungen relevant. „Bei einer großangelegten Studie haben wir drei Genorte gefunden, die relevant für Anorexia nervosa sind, allgemein bekannt als Magersucht, und für die Gewichtsregulation. Als wir nachträglich geschlechterspezifisch analysierten, zeigte sich, dass die genetischen Varianten an einem dieser Genorte hauptsächlich bei Frauen für die Ausprägung des Körpergewichtes relevant sind.“ Das, so Hinney, ist besonders spannend, da die Anorexia nervosa deutlich häufiger im weiblichen Geschlecht diagnostiziert wird als bei Männern. Wie genau der Mechanismus funktioniert und wie die Erkenntnis für eine Therapie genutzt werden kann, ist noch unklar.
Eine ähnliche Erfahrung hat Privatdozentin Dr. Andrea Kindler-Röhrborn vom Institut für Pathologie gemacht: Bei einer Studie wurde Ratten eine krebserregende Substanz verabreicht. Auffällig: Die männlichen Tiere entwickelten deutlich häufiger Tumoren; und wenn bei den weiblichen Tieren welche entstanden, dann erst nach einer doppelt so langen Zeit. Warum das so ist, wird derzeit untersucht, indem Genorte ausfindig gemacht werden, die etwas mit der Entstehung oder der Resistenz gegenüber Tumoren zu tun haben. Zwei Hinweise aus vorherigen Forschungen gibt es bereits: (a) Es gibt bestimmte Tumorresistenzgene im Körper. Wenn diese auf den X-Chromosomen liegen und eines dieser Gene eine Variante trägt, die zum Funktionsverlust führt, kann der Verlust bei Frauen durch das zweite X-Chromosom ausgeglichen werden; bei Männern, die nur ein X-Chromosom besitzen, aber nicht. Dieser Mechanismus führt dazu, dass bestimmte erbliche Krankheiten bei Frauen viel seltener auftreten als bei Männern. (b) Das Sexualhormon Östrogen, das bei Frauen in weit höheren Konzentrationen vorkommt als bei Männern, könnte einen schützenden Effekt haben – so wie es bereits für Herz, Kreislauf und Blutgefäße nachgewiesen wurde. Frauen leiden meistens bis zur Menopause seltener an den spezifischen Erkrankungen.
Klar war zudem schon länger, dass Männer etwa 1,8-mal häufiger an Krebs erkranken – bei den Analysen waren die Sexualorgane nicht mitberücksichtigt worden. „Männer haben biologisch gesehen schlechtere Karten als Frauen – und dann kommt auch noch oft eine ungesündere Lebensweise hinzu“, erklärt Kindler-Röhrborn weiter. Mehr Alkoholkonsum, weniger Bewegung oder ungesündere Ernährung, das alles kann die Entstehung von Tumoren begünstigen. Die Rolle von geschlechterspezifisch wirkenden Genvarianten und Hormonen – die „Big Player der Unterschiede bei den Geschlechtern“, wie die beiden Wissenschaftlerinnen sagen kommt nun nachweislich als zusätzliches Risiko hinzu. Die Ergebnisse dieser Forschung sollen zukünftig in eine an das Geschlecht angepasste Präventionsmedizin umgesetzt werden.
Wichtige Geschlechterunterschiede hat auch Arzu Oezcelik, Professorin für Viszerale Transplantation, bei ihrer Arbeit erkannt. Ein Beispiel: Bei Lebertransplantationen werden Frauen gleich doppelt benachteiligt. Zum einen erfolgt die Zuteilung der Spenderorgane nach dem MELD-Score (Model for End-stage Liver Disease). Dieses Punktesystem zeigt den Schweregrad einer Lebererkrankung an und wird nach bestimmten Laborwerten berechnet, die bei Männern und Frauen unterschiedlich ausgeprägt sind. Hierbei wird nicht nach Geschlechtern unterschieden. Das heißt konkret: Frauen sehen auf dem Papier oft gesünder aus als Männer, ohne dass das tatsächlich stimmen muss. Damit erhalten sie auf der Transplantationsliste eine schlechtere Platzierung. Zum anderen kommen die meisten Organspenden von Männern – und passen teils nicht in die kleineren und schlankeren Frauenkörper. Und wenn doch, stoßen Frauen diese Organe eher ab. Um das zu verhindern, müssen die Immunsuppressiva künftig geschlechterspezifisch dosiert werden.
»Wenn der Algorithmus nur mit männlichen Daten trainiert wird, kann der Computer auch nur daraus eine Diagnose und Therapie ableiten.«

KLEINE STELLSCHRAUBEN, GROSSE ÄNDERUNGEN
Dass nicht nur der Mensch geschult werden muss, zeigt auch die Erfahrung mit Künstlicher Intelligenz, die in der Medizin eine immer größere Rolle spielt. So arbeiten die Forschenden schon jetzt intensiv mit dem Campus-eigenen Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM) zusammen. Doch hier können Datenlücken und genderbedingte Verzerrungen sich ebenfalls ungünstig auswirken auf Forschung, Entwicklung und folglich Krankenversorgung. Anders ausgedrückt: Auch Algorithmen müssen divers agieren. „Wenn der Algorithmus nur mit männlichen Daten trainiert wird, kann der Computer auch nur daraus eine Diagnose und Therapie ableiten“, so Dr. Anke Diehl, Chief Transformation Officer an der Universitätsmedizin Essen und Konsortialführerin des KI.NRW-Flagshipprojektes SmartHospital.NRW, und macht deutlich, dass die analogen Fehler sich in der digitalen Welt nicht wiederholen dürfen.
Das Ziel der Forscherinnen ist klar: Alle Geschlechter sollen besser behandelt werden, individuell nach ihren Voraussetzungen. Wichtig ist ihnen aber auch: Frauen und Männer haben mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes. „Es ist wichtig, die unterschiedlichen Formen zu erkennen, zu erforschen und zu therapieren. Meist geht es dabei aber nur um kleine Stellschrauben wie eine andere Dosierung von Medikamenten. Manchmal müssen aber ganz neue Therapien her“, betont Hinney.
Eine Gruppe wird noch hinzukommen: non-binäre Menschen oder Transpersonen. Welche Behandlung passt für sie am besten? Solche und weitere Fragen stehen schon länger im Raum. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es sich um eine sehr kleine Gruppe handelt, es nur eine sehr geringe Datenlage gibt. „Aber künftig“, so Hinney, „wird das Thema sicherlich auch stärker in die Forschung und Behandlung eingehen.“
GENDERMEDIZIN WAR GESTERN
Obwohl „Gendermedizin“ in aller Munde ist, ist der Begriff „geschlechtersensible Medizin“ passender. Der Grund: Das englische Wort „Gender“ bezieht sich auf das soziale, das Wort „Sex“ auf das biologische Geschlecht – und um letzteres geht es in der biomedizinischen Forschung. Das Bewusstsein wird größer: Seit Ende 2022 gibt es das Netzwerk Geschlechtersensible Medizin NRW. Gegründet wurde es von den Medizinischen Fakultäten der Universitäten Aachen, Bielefeld, Bochum, Duisburg-Essen, Düsseldorf, Köln, Münster und Witten/Herdecke.
Titelbild: © Annika Huskamp



